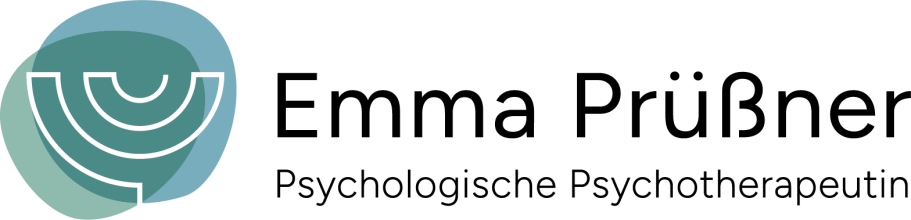ADHS bei Erwachsenen
Die Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung (ADHS) wird als neurobiologische Entwicklungsstörung verstanden, die nicht nur Kinder und Jugendliche betrifft, sondern auch bei Erwachsenen fortbestehen kann. Studien zeigen, dass knapp 5% der Erwachsenen betroffen seien können (Fayyad et al., 2007; Kessler et al., 2006). Dabei ist die Rate an Erwachsenen, die eine Behandlung erhalten jedoch deutlich geringer (Bachmann et al., 2017).

Typische Symptome bei Erwachsenen
Während sich ADHS im Kindesalter häufig durch motorische Unruhe und impulsives Verhalten zeigt, stehen bei Erwachsenen oft andere Symptome im Vordergrund.
Diese Symptome führen meist zu Einschränkungen im Berufsleben, in Partnerschaften oder im sozialen Miteinander. Zudem besteht ein erhöhtes Risiko für begleitende psychische Störungen wie Depressionen, Angststörungen oder Substanzmissbrauch (Kooij et al., 2010; Philipsen et al., 2017).
Konzentrationsprobleme, z. B. Schwierigkeiten, bei Aufgaben am Ball zu bleiben, schnelles Abschweifen
Desorganisation und Planungsprobleme im Alltag
Innere Unruhe oder ein ständiges Gefühl von Getrieben-Sein
Impulsivität, z. B. durch vorschnelles Reden oder Handeln
Emotionale Dysregulation, z. B. Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen
Vergesslichkeit oder das Verlegen von Gegenständen
Geringes Selbstwertgefühl, häufig infolge lebenslanger Leistungsprobleme
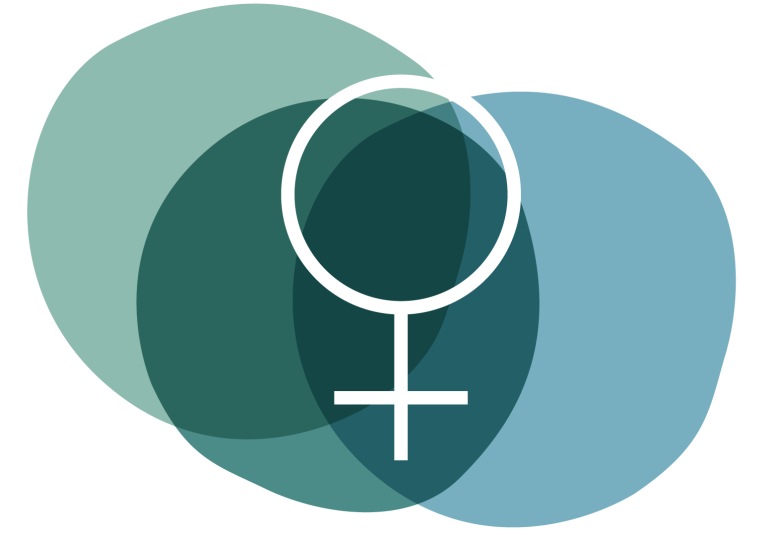
ADHS bei Frauen
ADHS kommt bei Mädchen und Frauen seltener vor und bleibt häufig lange unentdeckt (Quinn & Madhoo, 2014; Attoe & Climie, 2023). Es wird nach derzeitigem Forschungsstand davon ausgegangen, dass sich die Symptome oftmals anders als bei Jungen oder Männern äußern. Während Jungen häufiger durch impulsives oder störendes Verhalten auffallen, zeigen sich Mädchen und Frauen häufiger verträumt, still und fallen daher im schulischen oder beruflichen Kontext seltener negativ auf.
Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass Frauen kompensatorische Strategien entwickeln, um ihre Schwierigkeiten zu verbergen. Die Folgen können chronische Erschöpfung, Selbstzweifel und ein erhöhtes Risiko für Depressionen, Angststörungen oder Essstörungen sein (Quinn & Madhoo, 2014). Viele erhalten erst im Erwachsenenalter – oft im Rahmen einer Depressionsdiagnostik – die eigentliche ADHS-Diagnose.
Ein geschlechtssensibler Blick* in der Diagnostik ist deshalb besonders wichtig. Die Erkenntnis, dass ADHS die Ursache für langjährige innere Anspannung und Selbstkritik sein kann, empfinden viele Frauen als entlastend und als ersten Schritt zu mehr Selbstmitgefühl und einem neuen Umgang mit sich selbst.
*entsprechende Forschung in Bezug auf weitere Geschlechtsvariationen ist bisher nicht bekannt, weshalb an dieser Stelle nur Aussagen zu den binären Geschlechtern vorgenommen werden.
Neurobiologische Grundlagen
Die Forschung zeigt, dass ADHS mit einer Dysregulation der Neurotransmitter Dopamin und Noradrenalin im Gehirn assoziiert ist – insbesondere in den frontostriatalen Netzwerken, die an Aufmerksamkeit, Impulskontrolle und Motivation beteiligt sind (Arnsten, 2009; Faraone et al., 2015). Funktionelle Bildgebungsstudien zeigen zudem veränderte Aktivierungsmuster in Regionen wie dem präfrontalen Kortex, den Basalganglien und dem Kleinhirn, die für die Steuerung von exekutiven Funktionen wie Impulskontrolle und Handlungsplanung relevant sind (Cortese et al., 2012).

Diagnosestellung
Die Diagnostik eines ADHS im Erwachsenenalter ist komplex und setzt eine umfassende Anamnese voraus. Wichtig ist dabei insbesondere der Nachweis einer symptomatischen Ausprägung bereits im Kindesalter. Diagnostische Schritte beinhalten:
• Eine ausführliche klinische Anamnese
• Standardisierte Fragebögen (z. B. HASE)
• Strukturierte Interviews (z. B. DIVA-5; Diagnostisches Interview für ADHS im Erwachsenenalter)
• Ein Screening auf begleitende Störungen (z. B. Angst, Depression, Persönlichkeitsstörungen)
• Wenn möglich: Fremdanamnesen, z. B. durch Eltern oder Schulzeugnisse
Differenzialdiagnostisch müssen andere Ursachen für die Konzentrations- und Leistungsprobleme ausgeschlossen werden – etwa chronischer Stress, Depressionen oder Traumafolgestörungen.
Behandlung
Ein multimodales Behandlungskonzept hat sich in der Therapie von ADHS im Erwachsenenalter bewährt. Es umfasst in der Regel medikamentöse, psychotherapeutische und ggf. psychoedukative Maßnahmen:

Pharmakotherapie
Medikamente gelten laut aktueller Leitlinien als eine der effektivsten Behandlungsformen für ADHS (AWMF S3-Leitlinie, 2018). Zum Einsatz kommen primär:
• Stimulanzien wie Methylphenidat oder Amphetaminsalze
• Nicht-Stimulanzien wie Atomoxetin
Diese Substanzen verbessern die Verfügbarkeit von Dopamin und Noradrenalin im synaptischen Spalt und können zu einer deutlichen Reduktion der Kernsymptome führen.

Psychotherapie
Die kognitive Verhaltenstherapie (KVT) ist besonders wirksam in der Behandlung erwachsener ADHS-Betroffener (Knouse & Safren, 2010). Sie fokussiert auf:
• Selbstmanagement und Alltagsstrukturierung
• Strategien zur Emotionsregulation
•Verbesserung von Impulskontrolle und Selbstorganisation
•Bearbeitung von Selbstwertproblemen und komorbiden Belastungen
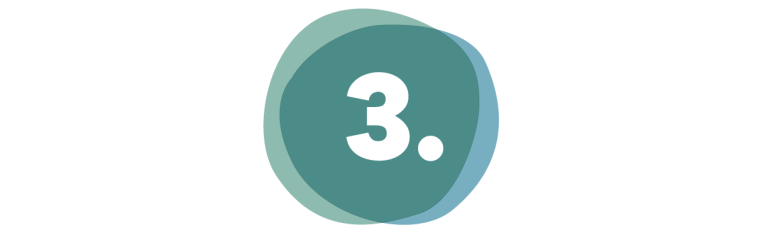
Psychoedukation
Ein verbessertes Verständnis der eigenen Symptome unterstützt Betroffene darin, begleitende Herausforderungen zu bewältigen. Hierzu zählt auch die Beratung des sozialen Umfelds, z. B. von Partner:innen oder Angehörigen.

Ein unbehandeltes ADHS kann die Lebensqualität erheblich einschränken. Viele Betroffene erhalten erst im Erwachsenenalter eine Diagnose, nachdem sie bereits einen langen Leidensweg hinter sich haben.
Eine fundierte Diagnostik und Therapie kann eine deutliche Verbesserung des psychischen Wohlbefindens und der Lebensführung bewirken.
Quellen (Auswahl)
- Arnsten, A.F.T. (2009). The Emerging Neurobiology of Attention Deficit Hyperactivity Disorder: The Key Role of the Prefrontal Association Cortex. Journal of Pediatrics, 154(5), I–S43.
- Attoe, D.E., & Climie, E.A. (2023). Miss. Diagnosis: A Systematic Review of ADHD in Adult Women. Journal of Attention Disorders, 27(7) 645 –657.
- Bachmann C.J., Philipsen A., & Hoffmann F. (2017). ADHD in Germany: trends in diagnosis and pharmacotherapy—a country-wide analysis of health insurance data on attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in children, adolescents and adults from 2009–2014. Deutsches Ärzteblatt International 2017, 114, 141–8.
- Cortese, S. et al. (2012). Toward systems neuroscience of ADHD: a meta-analysis of 55 fMRI studies. American Journal of Psychiatry, 169(10), 1038–1055.
- Faraone, S.V., Biederman, J., & Mick, E. (2006). The age-dependent decline of attention deficit hyperactivity disorder: A meta-analysis of follow-up studies. Psychological Medicine, 36(2), 159–165.
- Fayyad, J. et al. (2007). Cross-national prevalence and correlates of adult attention-deficit hyperactivity disorder. The British Journal of Psychiatry, 190(5), 402–409.
- Kessler, R.C. et al. (2006). The prevalence and correlates of adult ADHD in the United States: Results from the National Comorbidity Survey Replication. American Journal of Psychiatry, 163(4), 716–723.
- Kooij, S. J. J., et al. (2010). European consensus statement on diagnosis and treatment of adult ADHD: The European Network Adult ADHD. BMC Psychiatry, 10(1), 67.
- Knouse, L.E., & Safren, S.A. (2010). Current Status of Cognitive Behavioral Therapy for Adult Attention‐Deficit Hyperactivity Disorder. Psychiatric Clinics of North America, 33(3), 497–509.
- Quinn, P. O., & Madhoo, M. (2014). A Review of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Women and Girls: Uncovering This Hidden Diagnosis. The Primary Care Companion for CNS Disorders, 16(3).
- Philipsen, A., et al. (2017). Effects of group psychotherapy, individual counseling, and pharmacotherapy in adults with ADHD: A randomized clinical trial. JAMA Psychiatry, 74(6), 611–619.